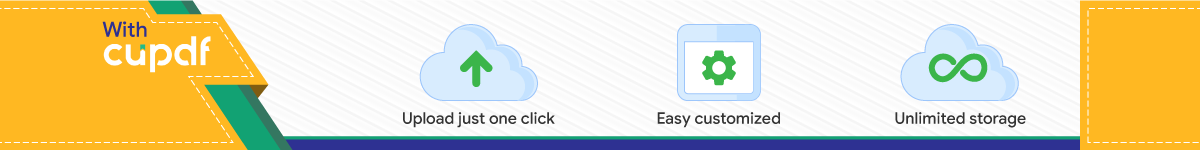
02 | HaysWorld 01/2011
DIE ENTDECKUNG DESSELBST
Wir kommen auf die Welt und nach wenigen Wochen entdecken wir unser Selbst: Ich bin wer. Aber wer?
HAYSWORLD 01/2011 · ENTDECKUNGEN
04 Kann man Glückstreff er planen? Zufällige Entdeckungen 09 Innovation ist ein sozialer Prozess Interview mit Prof. Dr. Frank T. Piller 11 Deutschland sucht die Superstars Talente entdecken
16 Loyale Mitarbeiter sind der beste Datenschutz Diebe entdecken
19 Krisen sind fester Bestandteil von Zukunftsforschung Interview mit Prof. Opaschowski
23 Tätern auf der Spur – Entdeckungen in der Kriminaltechnik 26 Die Entdeckung des Selbst
29 Die Entdeckung des Weltraums
31 News und Termine
26
DIE ENTDECKUNG DESWELTRAUMS
Gibt es außerirdisches Leben? Seit der Erkenntnis, dass die Erde nur Teil eines Planetensystems ist, zählt diese Frage zu den span-nendsten der Menschheit.
29
IMPRESSUM
Herausgeber: Hays AGMarketing/Corporate Communications Frank SchabelWilly-Brandt-Platz 1–3 · 68161 MannheimAufl age: 18.000Chefredaktion: Katharina LantelmeAutoren dieser Ausgabe: Annette Frank, Alexander Freimark, Jan Gelbach, Judith Gillies, Ina Hönicke, Britta Nonnast, Frank Schabel, Bernd SeidelGestaltung: srg werbeagentur ag, MannheimFotos: Mathias Ernert, fotolia, Christine Pulliam CfADruck: Dinner Druck GmbH, Schlehenweg 6, 77963 Schwanau, Ortsteil AllmannsweierKontakt:HaysWorld RedaktionTelefon: +49 (0)621 1788-1494 · E-Mail: [email protected]: Für den Nachdruck von Beiträgen – auch auszugsweise – ist die schriftliche Genehmigung der Redaktion erforderlich. Dies gilt auch für die Aufnahme in elektronische Datenbanken und für die Vervielfältigung auf elektronische Datenträger.Copyright © 2011 bei Hays AGAlle Rechte, insbesondere das Recht auf Verbreitung, Nachdruck von Text und Bild, Übersetzung in Fremdsprachen sowie Vervielfältigungen jeder Art durch Fotokopien, Mikrofi lm, Funk- und Fernsehsendungen, für alle veröff ent lichten Beiträge einschließlich Abbildungen vorbehalten.
INHALT
EDITORIAL
Unsere Welt steckt immer noch voller Entdeckungen.
HaysWorld 01/2011 | 03
LIEBE LESERINNEN UND LESER,
sehr systematisch zu. Während früher noch oft das omi nöse Bauchgefühl eines erfahrenen Managers ent-schied, ob ein Talent entdeckt wurde, werden heute wissenschaft liche Erkenntnisse genutzt, um die Talente innerhalb oder außerhalb des Unternehmens zu fi nden.
Um die Zukunft zu entdecken, arbeiten Zukunftswissen -schaftler wie Prof. Dr. Horst Opaschowski ebenfalls viele Daten auf. Es ist eine akribische und geduldige Arbeit, aus Dokumenten der Vergangenheit und der Gegenwart die Zukunft herauszulesen. Mit dem ominösen Blick in die Glaskugel hat dies überhaupt nichts zu tun.
Es gilt aber nicht nur, Dinge zu entdecken, sondern auch, sie zu verdecken und vor dem Zugriff unberechtigter Dritter zu schützen. Gerade in der globalisierten Wirtschaft wird es immer wichtiger, interne Daten und Ergebnisse so zu sichern, dass sie nicht öff entliches Gut werden.
Entdeckung ist also ein sehr vielschichtiger Begriff . Aber lesen Sie selbst mehr darüber. Wir freuen uns, wenn Sie in der Ihnen vorliegenden Ausgabe unserer HaysWorld einige interessante Artikel entdecken.
Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht Ihnen
Klaus Breitschopf
vor über 500 Jahren entdeckte Christoph Kolumbus per Zufall den neuen Kontinent Amerika, als er eigentlich auf dem Weg nach Indien war. Geografi sche Entdeckungen sind auf unserem kleinen Globus wohl kaum mehr zu machen. Aber trotzdem steckt unsere Welt immer noch voller Ent-deckungen. Und oft haben wir diese wie der berühmte Seefahrer gar nicht bewusst geplant, sondern sind eher zufällig auf sie gestoßen. So kommt es in der Forschung nicht selten vor, dass Naturwissenschaftler bei ihren Ver-suchsreihen „außerplanmäßig“ auf etwas Neues stoßen, was bahnbrechend ist. Denken wir beispielsweise nur an einige Medikamente, die auf diese Weise entstanden sind.
In der Kriminaltechnik sieht es anders aus. Hier wird aber auch gar nichts dem Zufall überlassen, sondern systematisch alles, was sich auswerten lässt, analysiert, um das entscheidende Puzzleteil zu entdecken. Der Erfolg spricht für sich, mehr und mehr Kriminalfälle werden gelöst, weil im Labor das entscheidende Indiz per Analyse entdeckt wurde.
Auch beim Talentmanagement, das die Führungskräfte von morgen entdeckt und fördert, geht es mittlerweile
04 | HaysWorld 01/2011
KANN MAN GLÜCKSTREFFER PLANEN?Sie kommen unerwartet, bringen alle Planungen durcheinander und ziehen gravierende Veränderungen nach sich: zufällige Erfi ndungen. Dennoch werden sie gern gesehen, schließlich sind sie das Salz in der Innovationssuppe.
Von Alexander Freimark und Bernd Seidel
Kolja Kuse kann Granit biegen, und das ist gar nicht schwer. Man muss nur wissen, wie. „Wir hatten von Beginn an das Gefühl, etwas Revolutionäres entdeckt zu haben – wie Amerika“, erinnert sich der leitende Anwendungsentwickler der Münchner Firma Techno-carbon Technologies. „Amerika“, das war in diesem Fall die Erkenntnis, eine mit Carbonfasern beschichtete Granitplatte biegen zu können, ohne den Stein zu zerreißen. „Wir waren verblüff t, erstaunt und gleich-zeitig besorgt, die Vielfalt der neuen Anwendungs-möglichkeiten gar nicht alle aufgreifen zu können“, berichtet der Entdecker.
Die Erfi ndung des Carbonfasersteins (CFS) war nicht das Ergebnis einer gezielten Suche, sondern purer
Zufall. Kuse wollte eine Küchenarbeitsplatte aus Granit mit unsichtbarer Induktionstechnik kombinie-ren, doch in den Versuchen war der Stein unter den heißen Töpfen stets gerissen. So reifte die Idee, den Granit mit einem zweiten Werkstoff am Riss zu hindern. Dies gelang nur mit Carbonfasern. Inzwischen steckt das biegsame Verbundmaterial, das nicht mehr wiegt als Aluminium, zu Anschauungszwecken auch in einer Gitarre, einem Ski und einer Hauswand. „Bis hin zum Bau ganzer Brücken ist alles denkbar. Wenn man das Phänomen nicht mit eigenen Augen sieht, kann man es tatsächlich kaum glauben“, sagt Kuse.
Während normale Innovationen als Motor des Fort-schritts gelten, bringen zufällige Erfi ndungen darüber
06 | HaysWorld 01/2011
hinaus noch strahlenden Glanz in die Welt der Forscher und tragen entscheidend zum Nimbus der Erfi nderbranche bei: Sie haben das Zeug zur Legende. Zufälle legen den Schluss nahe, dass sich ein Erfi nder in sein Labor einnistet und einfach abwartet, bis es Sterntaler vom Himmel regnet. Dass man nur ein paar Stunden mit Steinkohleteer spielen muss, damit der erste künstliche Süßstoff an den Fingern klebt.
Eindrucksvolle Beispiele für zufällige Entdeckungen gibt es viele: Charles Goodyear tropft versehentlich Kautschuk-Schwefel-Masse auf den heißen Ofen und dort verwandelt es sich in Gummi. Frank Epperson vergisst ein gefülltes Wasserglas mit Brausepulver und dem Rührstab über Nacht auf der Veranda – fertig ist das Eis am Stiel. Der Wirkstoff Sildenafi l gegen Bluthochdruck hebt nachweislich die Laune in der männlichen Körpermitte. Aus der Nebenwirkung wird ein prächtiges Alleinstellungsmerkmal.
Zufällige Erfi ndungen eröff nen eine neue Welt
Hinter den bekanntesten zufälligen Erfi ndungen steckt eine Systematik, die sie von gewöhnlichen Innovationen abgrenzt: Erstens wurden Zufallstreff er nicht gesucht, son-dern gefunden. Und zweitens ist der jeweilige „Fortschritt“ – hier wörtlich verstanden – größer als bei einer normalen Erfi ndung. Während Letztere den Horizont lediglich um ein paar Meter verschiebt, öff nen zufällige Erfi ndungen den Zugang zu einer neuen Welt: Leo Hendrik Baekeland suchte ein Lösungsmittel für teerhaltige Rückstände, experimentierte mit Phenol und Formaldehyd und konnte schließlich die zu
beseitigenden Rückstände nachbilden. Das Lösungs -mittel entdeckte er nicht, aber er hatte immerhin den Einfall, das neue Material als Werkstoff zu erproben. Mit dem Bakelit schuf er so den ersten Massenkunststoff der Welt. Thomas Sullivan schuf durch Zufall einen neuen Markt: Er verschickte Teeproben an potenzielle Kunden – jedoch nicht in der Blechdose, sondern in kleinen Seiden-säckchen. Einige Kunden legten den Beutel ins heiße Wasser, in der Annahme, das sei so vorgesehen. In den Jahrzehnten danach experimentierten andere Erfi nder mit verschiede-nen Stoff en, Heftklebern und Formen. Tee-Verpackungs-maschinen wurden konstruiert, Doppelkammerbeutel ersonnen, Schnüre mit Wachs überzogen. Ohne den Irrtum der ersten Kunden gäbe es womöglich einen Zweig der Nahrungsmittel industrie weniger – vielleicht wären aber auch die Erfi nder von Teesirup, Teeeiern oder Teesocken erfolgreicher geworden.
Rückblickend betrachtet, wirken zufällige Erfi ndungen in sich „logisch“ – es leuchtet ein, dass jemand zwangsläufi g darauf kommen musste. Des Pudels Kern wäre es also, die vermeintliche Logik nachzuvollziehen und für sich zu nutzen: Gibt es ein Umfeld, in dem zufällige Erfi ndungen besonders gut gedeihen? Angesichts der durchstrukturierten Forschung und Entwicklung in den Unternehmen liegt der Verdacht nahe, dass es dort keinen Raum für Zufälle mehr gibt – zumindest nicht innerhalb einer Versuchsreihe. Hier wird der Horizont systematisch erweitert, nicht eine neue Welt gesucht. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Freiraum, etwa für Kreativität und Unerwartetes, muss daher an anderer Stelle geschaff en werden.
Der britische Klimaökonom Lord Stern biegt Granit. Kolja Kuse (rechts im Bild) hatte zufällig entdeckt, dass ein verklebter Mantel aus Carbonfasern Brüche und Risse bei der Biegung des Steins verhindert. Insgesamt ist das Material nicht schwerer als Aluminium.
HaysWorld 01/2011 | 07
Zufällige Erfi ndungen – die Klassiker
Folgenreiche Wissensunfälle
Dr. Peter Schütt nennt die bahnbrechenden Erfi ndungen „Wissensunfälle“. Der Leiter Software-Strategie und Wissens-Management der Software Group von IBM Deutschland sieht den klassischen Ort für derartige „Unfälle“ in der Kaff ee-ecke beziehungsweise Teeküche, doch „leider skaliert der Ansatz nicht mit der Unternehmensgröße“. Schütt zufolge dreht sich alles um den zufälligen Austausch von Informa-tionen, die normalerweise in Silos abgeschottet sind. Fallen die Samen hingegen auf fruchtbaren Boden, können daraus
neue Pfl anzen wachsen – so geschehen bei 3M, als der Forscher Arthur Fry Lesezeichen in seinem privaten Gesang-buch fi xieren wollte. Den passenden Kleber, der hält und sich wieder ablösen lässt, hatte Jahre zuvor ein Kollege erfunden. Ein internes Seminar brachte den Sänger und den Klebstoff , der nicht vermarktet worden war, zusammen.
Allerdings ist vorher nicht bekannt, welcher Same auf welchem Nährboden Wurzeln schlagen wird. Also muss die abteilungsübergreifende Vernetzung intensiviert werden, um möglichst viele Kombinationen beim Informationsaus-
Erfi ndung Entdecker Hintergrund
Coca-Cola John Pemberton Geplant als Allheilmittel gegen Nervenschwäche und psychisches Unwohlsein von Stadtbewohnern.
Dynamit Alfred Nobel Instabiles Nitroglyzerin tropfte auf Kieselgur und explodierte überraschenderweise nicht.
Kunststoff Leo Hendrik Baekeland Die Suche nach einem Lösungsmittel für teerähnliche Rückstände führt zum ersten Kunststoff Bakelit.
Mauvein William Henry Perkin Bei Versuchen, Chinin zu synthetisieren, entstand der erste künstliche Anilinfarbstoff , das Mauvein.
Mikrowelle Percy L. Spencer Ein Schokoriegel schmolz in der Tasche des Forschers bei Arbeiten an Radaranlagen.
Penicillin Alexander Fleming Schimmelpilze in einer über die Sommerferien vergessenen Petrischale töteten Bakterien ab.
Radioaktivität Henri Becquerel Bei der Erforschung der Röntgenstrahlen wurde entdeckt, dass Uransalz fotografi sche Platten schwärzen kann.
Röntgenstrahlen Wilhelm Conrad Röntgen Ein fl uoreszierendes Material leuchtete auf, obwohl die Kathodenstrahlröhre komplett abgedeckt war.
Sicherheitsglas Edouard Benedictus Ein Glaskolben, in dem zuvor fl üssiges Zelluloid verdunstet war, fi el aus einem Regal und zersplitterte nicht.
Tefl on Roy Plunkett Nicht bei der Raumfahrt, sondern bei der Suche nach Kühlmitteln bildete sich der Stoff PTFE durch Zufall.
Viagra Nicholas Terrett, Peter Ellis et al. Das ursprünglich gegen Bluthochdruck konzipierte Präparat wurde wegen einer Nebenwirkung bei „Männerleiden“ eingesetzt.
08 | HaysWorld 01/2011
tausch zu ermöglichen. Das betriebliche Vorschlags -wesen greift zu kurz, andere Perspektiven bringen mehr Lösungsmöglichkeiten. So wie bei Pfi zer, wo ein Entwickler für Herzpräparate und ein Forscher für Potenzmittel das ganze Potenzial von Sildenafi l („Viagra“) im zufälligen Gespräch auf einer Konferenz erkannten.
Effi zienter und stetiger als über Kaff eeecken, Brain-storming-Meetings und fi rmeninterne Konferenzen (mit Pausen für das „Networking“) lassen sich Informationen etwa im Intranet sammeln, austauschen und kontrollieren. IBM-Fachmann Schütt berichtet von „Marktplätzen der Ideen“ und plädiert für Blogs von Mitarbeitern oder Wikis. IBM selbst veranstaltet regelmäßig einen „Jam“, auf dem bis zu 100.000 Mitarbeiter in moderierten Massen-Chats an zwei bis drei Tagen zusam menkommen. Das hilft nicht nur bei zufälligen Erfi ndungen, sondern auch bei der nor-malen Innovation. Mit Erfolg: Der Konzern führte 2010 das 18. Jahr in Folge die weltweite Rangliste der Unternehmen mit den meisten Patentanmeldungen an – knapp 5.900 Schutzrechte wurden beantragt.
Wer hat’s erfunden?
Wirklich innovative Unternehmen beziehen nicht nur ihre Mitarbeiter in den Innovationsprozess ein, sondern auch ihre Kunden, Partner, universitäre Einrichtungen und freie Erfi nder. Dadurch steigt die Chance, einen Glückstreff er zu landen. So werden viele Medikamente über ihr ursprüng-liches Einsatzgebiet hinaus eingesetzt, weil Ärzten zufällig positive Neben wirkungen aufgefallen waren. Bei dieser Form der „Open Innovation“ kann ein Unternehmen allerdings
nicht mehr sicher sein, dass eine zufällige Ent deckung immer in den eigenen Schoß fällt. Und generell gilt hier wie in anderen Bereichen: Legenden sind äußerst selten. Nur die zehn bis 20 Klassiker der zufälligen Erfi ndungen werden in der Regel als leuchtende Beispiele genannt. Dies ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs: Von 1790 bis 1975 hat das US-Patentamt 4,2 Millionen Patente vergeben, aktuell sind fast sieben Millionen Schutzrechte in der Datenbank, allein 220.000 Patente wurden vergangenes Jahr erteilt. „Ich würde mich niemals darauf verlassen, dass ein großer Zufallstreff er gelingt“, so der Rat des zufälligen Erfi nders Kuse. „Nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit passiert das ohnehin eher in kleinen Unternehmen als in Konzernen.“
Immerhin verfolgen einige Konzerne wie Google oder 3M moderne Wege, um ein innovationsfreundliches Klima zu schaff en – sie räumen ihren Mitarbeitern Arbeitszeit ein, in der sie eigene Projekte verfolgen können. Dabei geht es nicht um Mußestunden: „Das Problem ist nicht der Zufall, durch den bestimmte Ideen oder Erfi ndungen hervor-gebracht werden, sondern der Freiraum danach, um dem ‚Ergebnis des Zufalls‘ Raum zu geben und ein konkretes Produkt auszugestalten“, sagt Dr. Frank Piller, Professor für Techno logie- und Innovationsmanagement an der RWTH Aachen (siehe auch das Interview mit Prof. Dr. Frank Piller ab Seite 9).
Und wer kam auf die geniale Idee, Post-it® Notes in der Signalfarbe Gelb zu verkaufen? Auch das war ein Zufall: Erfi nder Arthur Fry hatte sich vom Forscherteam im Zimmer nebenan Papier für seine Klebeversuche ausgeborgt – und das war zufällig gelb.
Das ganze Potenzial von Sildenafi l („Viagra“) erkannten ein Entwickler für Herzpräparate und ein Forscher für Potenzmittel in einem zufälligen Gespräch auf einer Konferenz.
HaysWorld 01/2011 | 09
Interview mit Prof. Dr. Frank T. Piller
Der Begriff Innovation ist in aller Munde. Wird er nicht zu infl ationär benutzt?
In der Tat gibt es gegenwärtig einen Hype. Vor zehn Jahren wurde unter Innovation oft nur der Bereich Forschung und Entwicklung verstanden. Heute gilt alles als Innovation. Dabei gibt es große Erneuerungen nur selten. 90 Prozent aller Innovationen sind keine bahnbrechenden Produkte wie das iPhone, sondern schlicht Alltagsgeschäft in Form von Verbesserungen und neuen Varianten.
Natürlich gibt es gerade in Deutschland noch viele Unter-nehmen, die sich sehr erfolgreich durch Produktinnovationen diff erenzieren. Aber was heute den Markt aufrüttelt, sind mittlerweile Prozess- und Geschäftsmodellinnovationen. Im Sinne von Schumpeter, dem Begründer der Innovations-forschung, ist Innovation eine schöpferische Zerstörung bekannt-bewährter Prozesse. Das iPhone ist hierfür ein sehr gutes Beispiel: Es ist eine kombinatorische Innovation und hat vor allem den Verkauf von Musik revolutioniert – und damit eine ganze Branche.
Was verstehen Sie unter Innovation?
Als Wirtschaftswissenschaftler betrachte ich Innovation nicht nur unter dem Aspekt der kreativen Erfi ndung, son-dern vor allem unter dem der Verwertung. Wie lässt sich Innovation zu Geld machen und wie wird sie auf dem Markt platziert – dies sind meine Fragestellungen. Forschung heißt, Geld in Wissen zu transferieren. Innovation dagegen, Wissen in Profi t zu transformieren.
Wie wichtig ist Innovation für Unternehmen?
Überlebenswichtig. Die Frage lautet heute nicht mehr, ob und warum, sondern wie ich Innovation erfolgreich gestalte. Denn nachhaltiges Wachstum ist nur durch Erneuerung möglich. Selbst Unternehmen, die rein auf Kostenführer-schaft setzen, sind enorm innovativ – nicht beim Design, sondern vor allem in der Logistik und auf der Prozessebene.Das Spannende an Innovation ist, dass es keinen klaren Zusammenhang zwischen Input und Output gibt. Es gibt Firmen, die sehr viel Zeit und Kapital einsetzen, um Inno-vationen zu schöpfen, und trotzdem wenig Erfolg haben. Andere erreichen sehr viel mit relativ geringem fi nanziellem Aufwand. Innovation ist ein unsicherer und ein sozialer Prozess, bei dem es oft darum geht, Barrieren und Konfl ikte zu überwinden. Dieses Unstrukturierte macht das Thema so spannend, aber auch schwer greifbar. Innovation verläuft nicht linear.
Haben Deutsche mit ihrer Ingenieur-Prägung eine spezifi sche Auff assung von Innovation?
Wir sind in der Tat sehr gut im Bereich der technischen Exzellenz und damit der Produktinnovation. Nicht umsonst lautet der Slogan eines Automobilherstellers „Vorsprung durch Technik“. Unser Verständnis von Innovation ist oft B2B-lastig und kundengetrieben, gerade bei unseren vielen Hidden Champions im Mittelstand. Und das ist ja auf dem Weltmarkt eine sehr erfolgreiche Strategie. Bei Geschäfts-modell innovationen dagegen tun wir uns deutlich schwerer als andere Nationen. Hier fehlt uns teilweise die gedankliche
Prof. Dr. Frank T. Piller
Prof. Dr. Frank T. Piller lehrt am Lehrstuhl für Technologie- und Innovationsmanagement an der RWTH Aachen. Zwei seiner Schwer-punkte sind das Innovationsmanagement von Unternehmen sowie die neuen Ansätze um Open Innovation. Hier ist er weltweit einer der führenden Wissenschaftler.
INNOVATION IST EIN SOZIALER PROZESS
10 | HaysWorld 01/2011
und prozessuale Innovationsfähigkeit. Wir sind nicht das wandlungsfähigste Land, wenn es um radikalere Schritte geht.
Wo sehen Sie den richtigen Ort für Innovationen? Inhouse oder jenseits der eigenen Mauern?
Innnovation, die nur intern läuft, gibt es nicht (mehr). Die Vorstellung, eine Abteilung „Forschung und Entwick-lung“ sei gemeinsam mit dem Produktmanagement für Innova tion zuständig, ist antiquiert. Daniel Düsentriebs Gedankenblitz oder die zündende Idee unter der Dusche gibt es zwar noch ab und an. Aber es ist nicht das domi-nierende Muster. Innovation geschieht in Netzwerken und im Austausch. Inspiration geben Anregungen von außen. Dieser Prozess wird heute durch dedizierte Internetplatt-formen noch verstärkt – Stichwort „Open Innovation“.
Was spricht in diesem Zusammenhang dann noch für die eigene F&E-Abteilung?
Ohne sie geht es nach wie vor nicht. Sicher können Unternehmen einzelne Schritte besser nach außen ver-lagern. Aber sie benötigen immer einen zentralen Bereich, der die Teilstücke koordiniert, bewertet und vergleicht sowie die richtigen Fragen stellt. Dieser Bereich muss die gelieferten Technologien verstehen und im Kontext des Geschäfts modells seines Unternehmens analysieren. Zudem ist der F&E-Bereich die zentrale Schnittstelle hin zur Produktion.
Inhouse setzen Unternehmen auf ein systematisches Innovationsmanagement. Was halten Sie davon?
Dahinter steht die Idee, Innovationen als kreative und off ene Prozesse gleichzeitig zu regulieren. Auch wenn dies nach Widerspruch klingt: Dies geht und ist wichtig. Beim Innovationsmanagement gibt es eine strategische und eine operative Ebene. Operativ reden wir von Methodenbaukästen wie Brainstorming oder Bewertungsansätzen. Das beherr-schen viele Unternehmen gut. Die strategische Ebene ist die spannendere. Hier geht es um die Schaff ung der passenden Rahmenbedingungen, z. B. die Rekrutierung der passenden Mitarbeiter oder die Etablierung kreativer Freiräume.
Eine wesentliche strategische Fragestellung ist auch, wie Unternehmen ihren Innovationsprozess grundsätzlich aufsetzen. Setzen sie selbst auf die Kreation neuer Techno-logien oder eher auf eine produktive Verwertung dieser Technologien? Oder gehen sie beides parallel an. Viele Großkonzerne setzen heute eher auf die Ausbeutung neuer Ideen am Markt. Denn Erfi ndungen gelingen Startups meist wesentlich besser. Daher werden sie oft von den Großen geschluckt, die die Innovationen dann über ihre „Maschine“ produzieren und vermarkten. Dies ist eine Art makroökonomische Arbeitsteilung. Innovationsmanage-ment verlagert sich deshalb in vielen Konzernen eher in Richtung „New Business Development“. Nicht umsonst sitzen hier erfahrene M&A-Experten.
Dafür müssen Unternehmen aber wissen, welche zukunftsweisenden Unternehmen sie zu kaufen haben …
… und aus diesem Grund bedeutet Innovation immer mehr Bewertung: Wie erfasse ich, ob die innovativen Ideen eines Startups auf dem Markt verwertbar sind? Auch wenn Innovation immer als kreativer Prozess gilt, darf nicht ver-gessen werden, dass dazu auch viel Evaluation, Bewertung und Rechnerei gehört.
Wird Innovation in den wirtschaftlich stark aufstrebenden Staaten anders verstanden?
Teilweise ja, jedoch mit interessanten Unterschieden. China z. B. verfügt über eine sehr große Manpower und repliziert unser Innovationsmodell, das auf Hightech setzt, so wie wir es vor ca. 50 Jahren getan haben. Indien liefert dagegen ganz andere Beispiele. Hier geht man das Thema Innovation vergleichsweise unkoordiniert, aber aufgrund der Landeskultur sehr kreativ an. Es gibt tolle Beispiele im Bereich „frugal innovation“, d. h. Innovation, die den armen Bevölkerungsteilen nutzt. Armut wird quasi zu einer krea-tiven Ressource. Viele Inder können eine Operation nach westlichem Standard nicht bezahlen. Deshalb haben es lokale Entrepreneure z. B. im Bereich „grauer Star“ geschaff t, die Prozesse rund um die entsprechende Operation komplett neu zu organisieren. Folge: Eine OP, die in den USA 4.000 US-Dollar kostet, ist in Indien für 25 US-Dollar zu haben – bei gleicher Qualität. Von diesen Innovationsstrategien können wir noch viel lernen.
Forschung heißt, Geld in Wissen zu transferieren. Innovation dagegen, Wissen in Profit zu transformieren.
HaysWorld 01/2011 | 11
DEUTSCHLAND SUCHT DIE SUPERSTARSTalentscouting gilt in Sport und Wirtschaft als Schlüssel zum Erfolg von morgen. In einem spannenden Prozess zwischen richtigem Riecher und Recruiting werden Potenzialträger aufgespürt, gewonnen und gebunden.
12 | HaysWorld 01/2011
Wer dieser Tage Fernsehen schaut, muss zu dem Schluss kommen, Talentsuche sei ein leichtes Spiel. Ob Sänger oder Models, Tänzer oder Praktikanten – landauf, landab werden alle erdenklichen Berufe gecastet. Doch der Eindruck täuscht. Die Suche nach wirklichen Potenzialträgern ist kein Entertainment wie bei „Deutschland sucht den Superstar“, sondern hartes Brot. Wahre Talente blühen oft im Verbor-genen – im Sport genauso wie in der Wirtschaft.
Diese verborgenen Schätze aufzuspüren, ist Aufgabe von Talentscouts. Ausgestattet mit exzellenten Kontakten, einem professionellen Suchprofi l und dem richtigen Riecher werden sie von ihren Auftraggebern losgeschickt, um passende Kandidaten zu fi nden. Ein Job, der mit dem Entertainment-potenzial eines Dieter Bohlen oder dem Glamourfaktor einer Heidi Klum nichts zu tun hat – dafür aber umso mehr mit den Anforderungen der kommenden Jahrzehnte.
„Talentscouting ist ein wichtiges Thema der Zukunft. Ein entscheidender Erfolgsfaktor für Unternehmen wird es ein, trotz Demo grafi elücke und Fachkräftemangel die passenden Spezialisten zu fi nden“, sagt Christian Jost, Head of Talent Management bei Hays in Mannheim.
In einer Zeit, in der die Top-Player der Zukunft rar werden, tun Organisationen und Sportvereine gleichermaßen gut daran, sich für den Wettbewerb der kommenden Jahre zu rüsten. Darin sind sich Personalexperten einig. „Unternehmen sollten nicht über den Fachkräftemangel jammern, sondern besser über so innovative Instrumente wie Talent scouting nachdenken“, rät Professor Dr. Armin Trost, Recruiting experte mit Schwerpunkt Talentmanagement an der HFU Business School der Hochschule Furtwangen. Im Sport arbeitet man schon lange erfolgreich mit dem Modell. So z. B. Thomas Foj. Als Honorartrainer und Talentscout sichtet er für den
Von Judith Gillies
Talentscouts sind überall dort aktiv, wo sich die Zielgruppen der Unternehmen tummeln: etwa in Hörsälen, auf dem Campus, bei Facebook oder Twitter.
HaysWorld 01/2011 | 13
Deutschen Fußball-Bund die begabtesten zehnjährigen Nachwuchskicker. „Dabei kommt es nicht nur darauf an, ob jemand viele Tore schießt“, erklärt der 30-Jährige. Entscheidend sei vielmehr das Gesamtbild, das ein Spieler auf dem Platz abgibt: Technik und Team arbeit gehen in die Bewertung ein, Grundathletik, Übersicht, das generelle Auftreten. Doch damit nicht genug. „Die eigent liche Arbeit beginnt erst nach der Talentsuche, wenn man die Spieler formt, ihre Stärken aufbaut und die Schwächen minimiert“, so Foj. „Denn Talente brauchen Zeit, um sich zu entwickeln.“
Genau das gilt auch für Fachkräfte in der Wirtschaft. „Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist es, das Scouting in das Talentmanagement einzubinden“, betont Hays-Experte Jost. Es nütze nichts, Talente zu identifi zieren, wenn man sie nicht zu sich holen, aufbauen und an sich binden kann. Sobald sein Attraction-Team die richtigen Leute identifi ziert
hat, kümmert sich deshalb die Selection-Truppe um die Auswahl, die Development-Kollegen um die Entwicklung der neuen Mitarbeiter und schließlich die Retention-Gruppe um deren Bindung an die Organisation.
Auch T-Systems im schweizerischen Zollikofen setzt auf Talentscouting. Die klassische Mitarbeitersuche, bei der die große Masse angesprochen wurde, hat nicht die gewünschten Erfolge gebracht. Daher sind seit Anfang des Jahres nun auch Talentscouts im Einsatz. Zu den Studierenden will die Telekommunikationsfi rma auf diese Weise „Kontakt auf Augenhöhe aufbauen“, wie HR Specialist Sabine Aebischer sagt. Die T-Systems-Scouts sind über - all dort aktiv, wo sich die Zielgruppe des Unternehmens tummelt: in Hörsälen und Lehrstühlen, bei Facebook und Twitter. „Sie müssen sich in beiden Welten sicher bewegen: in der Studienwelt und in unserer Unternehmenswelt“,
14 | HaysWorld 01/2011
sagt Aebischer. „Nur so können sie unseren Spirit auf den rich tigen Kanälen und mit den richtigen Worten rüber-bringen.“ Das Modell scheint T-Systems erfolgversprechend. Zu den ersten Aufträgen der Spürnasen gehörte es, weitere Talent scouts zu fi nden.
Keine leichte Aufgabe. Denn die Job Description verlangt ihnen jede Menge ab. „Sie brauchen weit mehr als nur eine Spürnase und das richtige Bauchgefühl“, erklärt Jost. Wer erfolgreich als Scout arbeiten will, muss in der Zielgruppe exzellent vernetzt sein, Menschenkenntnis sowie ein Gespür für Potenziale mitbringen. Und natürlich sind auch Fach-kenntnisse aus dem gesuchten Bereich von Vorteil. „Wer einen neuen Philipp Lahm sucht, muss nicht unbedingt selbst Nationalspieler gewesen sein. Aber Fußball sollte er schon spielen“, sagt Jost augenzwinkernd.
Analog gilt das auch für die Wirtschaft. Die Scouts müs-sen sich selbst so selbstverständlich und sicher in der Welt der Kandidaten bewegen, dass sie nicht als Fremdkörper wahrgenommen werden. Schließlich sind sie zunächst einmal in geheimer Mission unterwegs – bei sportlichen
Wettkämpfen genauso wie bei Businesskonferenzen oder im Karrierenetz werk LinkedIn. „Ihre Arbeit hat durchaus etwas Hinterfotziges“, sagt HR-Professor Trost, „weil die Zielpersonen ohne ihr Wissen an einem Real-Life-Assessment-Center teilnehmen.“
Susi Lutz ist eine dieser verdeckten Ermittlerinnen. Auf der Suche nach Leichtathletikbegabungen arbeitet die 24-Jährige für Kids for Olympia in Regensburg. Sie schleust sich in Schulen ein, um dort offi ziell als Gastlehrer eine Sport-stunde zu gestalten. „Optimal läuft es dann, wenn die Kids dabei gar nicht merken, dass sie gerade getestet werden“, sagt die Leistungssportlerin. So kann sie die Nachwuchs-sportler in möglichst natürlicher Atmosphäre beobachten und schnell erkennen, wer Körpergefühl, Koordination, Eifer, Ehrgeiz und Auff assungsgabe mitbringt – die richtigen Voraussetzungen für eine Olympiateilnahme in spe.
Ein möglichst unverdächtiges Auftreten streben auch die Talentsucher in der Wirtschaft an – etwa wenn der Scout ein angebliches Kundengespräch vereinbart, bei dem er dem ahnungslosen Kandidaten auf den Zahn fühlt. Und auch bei
Wahre Talente blühen oft im Verborgenen – Talentscouting ist deshalb ein wichtiges Thema der Zukunft.
HaysWorld 01/2011 | 15
der Kandidatensuche im Web ist anfängliche Geheimhaltung ratsam. „Bei Facebook und anderen Netzwerken geht es darum, als Mitglied in der Community zu gelten – und nicht als Recruiter oder Marketingmensch. Aufdringliche Ansprache oder klassische Unternehmenswerbung werden als Spam wahrgenommen“, erklärt Sabine Neumann, Human Resource Manager der SPV Solutions, Products, Visions AG.
Die Münchener SAP-Beratung hat vor einigen Monaten ihren ersten Talentscout eingestellt. Ohne ging es nicht mehr. „Der Kandidatenmarkt im SAP-Umfeld wird immer enger“, sagt Neumann. Als kleiner Mittelständler müsse man daher neue Wege gehen. Neumann sieht auch ihren Berufsstand vor großen Umwälzungen. „Als HR-Manager müssen wir umdenken“, so ihre Einsicht. „Einfach eine Anzeige zu schalten und abzuwarten, wer sich meldet, funktioniert nicht mehr.“
Mit dieser Erkenntnis gehört Neumann zu den Vorreitern in den Personalabteilungen. Das Gros steht dem innova-tiven Recruitinginstrument nicht so aufgeschlossen gegen-über. „Viele Unternehmen tun sich noch schwer mit Talent-
scouting“, beobachtet Professor Trost. Er vermutet, dass dies auch am gegensätzlichen Temperament von Scouts und Recruitern liegt: „Profi talentscouts sind oft coole Typen, die Spaß daran haben, den Günter Wallraff zu spielen ...“
Dazu kommt, dass auch Scouts keine Talente backen können – und dass zwischen der Entdeckung und der Entwicklung des vollen Potenzials oft Jahre vergehen. Nur im Fernsehen steht schon von Anfang an fest, dass am Ende der jeweiligen Staff el Deutschlands Superstar oder Germany’s next Topmodel gefunden werden wird.
In der Realität gehört ein langer Atem zur Grundaus-stattung guter Scouts. Den hat Talentscout Lutz als Lang-streckenläuferin ohne Frage. Daher ist sie auch nicht enttäuscht, dass bisher noch keine ihrer Entdeckungen bei Olympia mitmachen konnte. „Aber einige sind schon auf einem guten Weg“, so Lutz. Zwei der Mädchen, die sie 2006 gesichtet hat, laufen heute schon in ihrem eigenen Training mit – statt 1.000 zwar nur 400 Meter, aber immer-hin trainieren sie mit den Großen. „Ich weiß gar nicht, wer darauf stolzer ist: sie oder ich!“, sagt Lutz und strahlt.
Die Gewinner können mit einer 200-fachen Vergrößerung auf Entdeckungstour gehen. Einfach an den PC anschließen und los geht’s. Senden Sie eine E-Mail mit der richtigen Lösung an: [email protected], Stichwort „Entdeckungen“. Einsendeschluss ist der 15. Juli 2011. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Gewinnfrage: Wie nennt man Suchprofi s, die nach vielver-sprechenden jungen Sportlern Ausschau halten?
GEWINNSPIELHays verlost drei USB-Mikroskopkameras für eigene Entdeckungen
16 | HaysWorld 01/2011
LOYALE MITARBEITER SIND DER BESTE DATENSCHUTZ Gerade innovationsfreudige Unternehmen leiden nicht selten unter Krimi-nellen, die ihre Ideen klauen, illegal kopieren oder Daten an Mitbewerber verkaufen. Hundertprozentigen Schutz dagegen gibt es nicht – aber Schäden können zumindest minimiert werden.
HaysWorld 01/2011 | 17
Von Ina Hönicke
Intercity München–Düsseldorf: Junge Männer im dunklen Zwirn schlagen sich in einem Großraumabteil begeistert auf die Schulter, weil der Termin bei einem Elektronikkonzern so erfolgreich war. Geradezu euphorisch besprechen sie jede Menge Details des neu entwickelten und jetzt gemeinsam zu vertreibenden Produkts. Dass dieses Gespräch besser nicht coram publico hätte über die Bühne gehen sollen, merken sie spätestens, als sie zu einem Gespräch bei ihrem Vorgesetzten zitiert werden.
Natürlich ist ein solches Öff entlichmachen von brisanten Details weder der Normalfall noch kriminell, sondern grob fahrlässig. Doch in einem erheblich größeren Umfang leiden Unternehmen unter echten Wirtschaftskriminellen, die Daten stehlen, sie sich illegal beschaff en oder verkaufen. Dabei zieht sich Wirtschaftskriminalität quer durch alle Branchen. Pharma-fi rmen bezichtigen Mitbewerber des Ideenklaus bei neuen Medikamenten, IT-Unternehmen wie Nokia oder Microsoft werfen Konkurrenten Patentdiebstahl vor und Handykonzerne wie Motorola wundern sich, wenn kurz nach Veröff entlichung eines neuen Designs Handys auftauchen, die ihrem eigenen Modell sehr ähnlich sehen. Eines steht fest: Es handelt sich in all diesen Fällen nicht um Kavaliersdelikte. Hier geht es um Geld, um sehr viel Geld. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) schätzt, dass allein seine Mitgliedsunternehmen jährlich einen Schaden von mehreren Milliarden Euro durch Produkt- und Markenpiraterie erleiden. Da aber der Erfi ndergeist von Unternehmen gerade in einem Land wie Deutschland überlebenswichtig ist, wird auch der Schutz vor Ideenklau und Nachahmung immer wichtiger.
„Kriegsgewinnler“ dieser misslichen Lage sind neben Sicher-heitsfi rmen vor allem Patentanwälte. „Hinter einer Erfi ndung steht immer mindestens eine Person“, erklärt der Münchener Patentanwalt Albrecht Dehmel. Handle es sich um einen Arbeitnehmer, sei dieser über das Arbeitnehmer fi nder gesetz verpfl ichtet, die Erfi ndung dem Arbeitgeber zu melden. Während Konzerne zumeist eine Rechts- oder sogar Patent-abteilung unter ihrem Dach hätten, sollten kleinere Firmen rasch einen Patentanwalt einschalten. Denn von dem Zeit-punkt an, an dem die Patentanmeldung eingereicht ist, hat das Unternehmen einen Beleg, dass die Erfi ndung ihm gehört. „Trotzdem gibt es immer wieder Böswillige, die die Erfi ndung eines anderen Unternehmens nutzen“, erklärt der Patentanwalt. Um dagegen vorzugehen, brauche eine Firma gegebenenfalls viel Geld. Sei dieser fi nanzielle Background nicht vorhanden, kann es laut Dehmel durchaus auch mal angeraten sein, das Wissen über eine neue Idee im Unter-nehmen geheim zu halten. Der Patentanwalt: „Nach innen wird es nur der Abteilung bekanntgegeben, die es gerade benötigt, nach außen darf nichts dringen.“ Für Dehmel steht fest, dass es trotz diverser Schutzmaßnahmen die hundert-prozentige Sicherheit gegen Ideenklau nicht gibt.
18 | HaysWorld 01/2011
Jörg Schecker, langjährig erfahrener Informationssicher-heitsexperte und Inhaber von Pointhope, vergleicht Ideen mit einem Puzzle: „Ein Mitarbeiter hat nicht einfach eine Blitzidee, dahinter steht ein langer Entwicklungsprozess.“ Deshalb müssten alle Beschäftigten, die an der Entwicklung mitwirkten, dafür sensibilisiert werden, wie wertvoll und gefährdet selbst Teilinformationen sind. Kurzum: Wer darf welche Daten sehen, wie vertraulich müssen sie gehandhabt werden, inwieweit sind sie für Mitbewerber interessant?
Auf Basis dieser Risikobewertung können frustri erte Mitarbeiter, die ihren Arbeitgeber im Schlechten verlassen, nicht allzu viele Informationen mitnehmen und missbrau-chen. „Hier kommt es darauf an, wie viel der Beschäftigte über ein neues Produkt weiß“, erklärt Schecker. „Besitzt er Informationen über die gesamte Prozesskette, kann er in der Tat großen Schaden anrichten.“ Handle das Unternehmen allerdings nach einem ausgewogenen „need to know“-Prinzip, kenne der Mitarbeiter nur die Details, die er für seinen Job benötige. Damit werde das Risiko minimiert. Das Gleiche gelte für Mitarbeiter, die gedankenlos, fahr-lässig oder aus Überzeugung Daten an andere weitergeben. Fazit des Sicherheitsexperten: „Die Technik für den Schutz von Ideen ist vorhanden, die Verantwortung liegt allein beim Menschen.“
Wie aber reagieren Verantwortliche in den Unternehmen auf das Damoklesschwert des Ideenklaus? Einhelliger Tenor der Befragten: Einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht, diverse Sicherheitsmaßnahmen dagegen schon.
So sollte der Kreis derer, die an neuen Entwicklungen teilhaben, nicht nur überschaubar gehalten werden, sondern die Beteiligten sollten auch vertrauenswürdig sein. Darüber hinaus sollten nicht alle Mitarbeiter Informationen über die gesamte Prozesskette, sondern nur über einzelne Schritte besitzen. Der beste Schutz, darin sind sich die Chefs einig, sind indes loyale Mitarbeiter. Letztlich würden die besten technischen Schutzmaßnahmen nichts nutzen, wenn die Beschäftigten unzufrieden sind. Fazit: Loyalität ist sicherer als jeder Datenschutz.
Dass die Google-Algorithmen gehackt wurden, geistert zwar immer wieder als Gerücht durch die Internetwelt – bewahrheitet hat sich diese Information nie. Wenn es jemals dazu kommen würde, könnten sich viele Unternehmen warm anziehen. Schließlich basieren Millionen von ihnen auf den Services von Google. Eine „versehentliche“ Bekanntgabe der Geheiminformationen ist nicht zu erwarten, denn der Algorithmus wird durch ein ausgeklügeltes Sicherheitsystem geschützt.
GESCHÜTZT WIE IN FORT KNOX
„Nach innen wird das Wissen über eine neue Idee nur der Abteilung bekanntgegeben, die es gerade benötigt, nach außen darf nichts dringen.“Patentanwalt Albrecht Dehmel
Jörg Schecker, Informations -sicherheitsexperte und Inhaber von Pointhope
HaysWorld 01/2011 | 19
KRISEN SIND FESTER BESTANDTEIL VON ZUKUNFTSFORSCHUNG
Interview mit Prof. Dr. Horst W. Opaschowski
Wie schauen Sie in die Zukunft?
Zukunft ist für mich zuerst einmal Herkunft. Ich muss zurückschauen, um nach vorn blicken zu können. Als Zukunftsforscher bin ich durchaus seelenverwandt mit der Geschichtsforschung. Das gesellschaftliche Geschehen läuft – wie in der Natur – in Zyklen ab. Es ist oft die ewige Wiederkehr des Gleichen. So sind zum Beispiel Krisen, öko-logische oder ökonomische, ein Stück Normalität. Ich muss als Zukunftsforscher nur darauf achten, dass wir gut darauf vorbereitet sind. Ich habe also eine Bringschuld.
Welche Informationen und Materialien ziehen Sie dafür heran?
Ich verlasse mich nur auf verlässliche Daten, also auf repräsentative Erhebungen im Zeitvergleich der letzten 30 Jahre. Die Natur macht keine Sprünge und der Mensch auch nicht. Dabei lautet meine Hauptfrage: Wie wollen wir in Zukunft leben? Nur am Rande interessiert mich die Frage, was technologisch alles möglich ist.
20 | HaysWorld 01/201120 | HaysWorld 01/2011
Prof. Dr. Horst W. Opaschowski
Prof. Dr. Horst W. Opaschowski ist wissen -schaftlicher Leiter der renommierten Stiftung für Zukunftsfragen. Im In- und Ausland hat er sich als „Mr. Zukunft“ (dpa) einen Namen gemacht und ist international in Politik und Wirtschaft als Berater gefragt. Seit über 30 Jahren erforscht er die Lebensgewohn heiten der Deutschen. Seine fundierten Analysen und Prognosen – auf der Basis repräsentativer Erhebungen – stoßen auf ein starkes Interesse in Wissenschaft, Forschung und Fachöff entlichkeit.
HaysWorld 01/2011 | 21
Wie erkennen Sie daraus starke Trends?
Ein Zukunftstrend von der Globalisierung bis zur Alte-rung der Gesellschaft muss mindestens 15 Jahre lang richtungsweisend sein. Dadurch unterscheidet er sich wesentlich von kurzlebigen Moden oder Zeitgeistströmungen. Aber auch im Detail kann ich Trendprognosen machen: So ist z. B. der TV-Konsum seit 30 Jahren stabil, während das Bücherlesen zurückgeht und der Anteil der Internet-nutzer immer größer wird. Die nächste Generation wird anders sein und anders leben.
Wie gehen Sie dabei mit Ungewissheiten um?
Zukunftsforschung ist Innovations- und Risikoforschung zugleich. Die Chinesen haben für Risiko und Chance nur ein Schriftzeichen, die Zukunftsforschung auch. Ein Zukunfts-forscher muss – denken Sie an Fukushima – auch das Undenk -bare denken und Antworten auf die Frage geben können, was passiert, wenn nichts passiert, wenn wir die Richtung nicht ändern oder gegensteuern. Ungewissheiten und Unwägbarkeiten müssen immer mitbedacht werden. Aus der Sicht der letzten 100 Jahre lässt sich beispielsweise ableiten: Jedes Jahrzehnt hatte seine Krise, seine Zäsur, sein zeit-geschichtliches Ereignis, mit dem wir im wahrsten Sinne des Wortes rechnen mussten. Das gilt für den 11. September 2001 genauso wie für den Super-GAU in Japan.
Welche Rolle spielt die geschichtliche Entwicklung in ihren Überlegungen?
Aus der Geschichte kann ich lernen, nicht mehr und nicht weniger. Wichtige Signale für geschichtliche Entwicklungen sind für mich Strukturwandel, Wertewandel und sozialer Wandel. So gesehen schreibe ich beinahe eine Geschichte der Zukunft. Das Morgen fi ndet heute schon statt.
Haben Sie schon Trends entdeckt, die keine Wurzeln in der Gegenwart hatten?
Ich nenne Ihnen einige Beispiele: In den achtziger Jahren sagte ich den Trend vom Fitness zum Wellness voraus, in den neunziger Jahren die Entdeckung einer neuen „Generation@“, im Frühjahr 2000 die Enttarnung der New Economy als Luftblase. Die Treff sicherheit meiner Prognosen ist groß, weil es mir immer nur um eine Frage geht: Was will der Mensch oder was will der Verbraucher?
Wie gehen Sie mit der Schnelllebigkeit um, die vieles in Monaten über den Haufen wirft?
Ich bin nicht nur Gesellschafts-, sondern auch Verhaltens-forscher. Vor 30 Jahren habe ich eine Entschleunigung des Lebens gefordert, damit Stress und Burnout-Probleme verhindert werden. Ein fast aussichtsloses Unter fangen – ganz im Gegenteil: Die Nonstop-Gesellschaft wird immer schnelllebiger und ist kaum zu bremsen. Die Computeri-sierung und Mediatisierung des Lebens sind die Haupt-ursachen hierfür.
Wie beziehen Sie nicht vorhersehbare Krisen ein, die Trends stark beeinfl ussen?
Bei meinen Trendaussagen können mich Krisen nicht überraschen. Sie können sich doch Ziele im Leben setzen, ohne sich gleich von kleinen oder großen Krisen aus der Bahn werfen zu lassen. Im Übrigen gilt für mich als Zukunftsforscher: Ich darf Trends nicht einfach gradlinig in die Zukunft verlängern. Ich rechne mit Brüchen, mit Umbrüchen und Unterbrechungen, wie im privaten Leben auch.
HaysWorld 01/2011 | 21
„Ein Zukunftsforscher muss – denken Sie an Fukushima – auch das Undenkbare denken und Antworten auf die Frage geben können, was passiert, wenn nichts passiert, wenn wir die Richtung nicht ändern oder gegensteuern.“
Prof. Dr. Horst W. Opaschowski
22 | HaysWorld 01/2011
Gibt es überhaupt den stabilen Trend oder nicht doch eher Milieutrends?
Alter, Bildung, Lebensphasen und Lebensmilieus haben schon immer für ganz spezifi sche Ausprägungen gesorgt, dazu zählen genauso Regionen und Religionen. In meinen Analysen und Prognosen unterscheide ich deutlich zwischen Jung und Alt, Weiblich und Männlich, Arm und Reich, Großstädtern und Landbewohnern. Das heißt, Unterschiede sind für mich genauso spannend und interessant wie Gemeinsamkeiten.
Wie werden wir in 20 Jahren kommunizieren?
Wir werden in Zukunft mehr mit Medien als mit Menschen kommunizieren, so wie das Kinder und Jugendliche heute schon tun. Oft telefonieren sie mehr mit Freunden, als dass sie sich mit Freunden treff en. Die Zukunft gehört einem Medien- und Kommunikationsmix. Wir werden da nicht mehr zwischen TV, PC und Telefon unterscheiden können.
Welche Rolle spielen soziale Medien?
Soziale Medien werden zu einer neuen gesellschaftlichen und politischen Kraft und Macht, wie der Aufbruch und die Unruhen in Ägypten und Tunesien bewiesen haben. Die sozialen Medien werden zu einem Sprachrohr der Bürger, zu einer Art medialem Volksentscheid, der die Politiker nicht mehr zur Ruhe kommen lässt.
Und welche Konfl ikte zeichnen sich ab?
Die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich sowie die ungelösten Integrationsprobleme bei Zu- und Einwan-derern werden die Hauptkonfl ikte der Zukunft sein, zumal wir weltweit mit einer Migrationswelle unvorstellbaren Ausmaßes rechnen müssen, z. B. von Afrika nach Europa. Einen Konfl ikt aber wird es nicht geben: den Generationen-konfl ikt. Ganz im Gegenteil: Die Qualität der Generationen-beziehungen wird der soziale Kitt der Zukunft sein.
„Die Treffsicherheit meiner Prognosen ist groß, weil es mir immer nur um eine Frage geht: Was will der Mensch oder was will der Verbraucher?“
Prof. Dr. Horst W. Opaschowski
HaysWorld 01/2011 | 23
TÄTERN AUF DER SPUR – ENTDECKUNGEN IN DER KRIMINALTECHNIK
In den Fernsehkrimis rücken die Kriminaltechniker in weißen Overalls mit Handschuhen, Füßlingen und Kapuzen an. Doch wie sieht ihre Arbeit tatsächlich aus? Und vor allem: Wie geht es nach der Spurensicherung am Tatort im Labor weiter?
Das Bild der eingehüllten Spezialisten stimmt. „Aber“, so erklärt Horst Haug, Pressesprecher des Landeskrimi-nalamtes (LKA) von Baden-Württemberg, „im Gegensatz zu den Serien wie CSI gibt es in Deutschland eine strikte Trennung zwischen Ermittlern und Spurenanalyse im Labor.“ Rund 150 Mitarbeiter sind im Kriminaltechnischen Institut des LKA beschäftigt, 45 davon allein im Bereich Molekulargenetik. In ihren Laboren wurde ein Meilenstein der Verbrechensbekämpfung gelegt: 1989 konnte in Deutschland zum ersten Mal ein Fall mithilfe von DNA-Beweismaterial gelöst werden. Die Analyse lieferten die
Von Annette Frank
24 | HaysWorld 01/2011
Stuttgarter. Sie machten zusammen mit dem Bundes-kriminalamt (BKA) und dem LKA Berlin die DNA-Analyse für forensische Zwecke nutzbar. Seitdem trug die Methode zur Aufklärung von unzähligen Verbrechen bei.
Früher benötigten die Kriminaltechniker noch mit dem bloßen Auge sichtbare Spuren zur Analyse. „Heute reicht ein Milliardstel Gramm DNA aus“, erklärt Haug. „Auch als die DNA-Analyse noch nicht bekannt war, sicherte man Beweismittel wie zum Beispiel die Kleidung der Opfer. Mord verjährt ja nie. Solange die Akte off en ist, schauen wir systematisch, ob noch weitere Spuren auf den Beweis-mitteln vorhanden sind, die sich mit heutigen Methoden untersuchen lassen.“ Sachgemäß gelagert, ist der genetische Fingerabdruck jahrzehntelang haltbar. Mittlerweile werden viele Fälle Jahre nach der Tat aufgeklärt. Wie der Reiterhof-Mordfall von Großbottwar bei Ludwigsburg. 1984 wurde eine Zwölfjährige in einer Scheune vergewaltigt und erdrosselt. 19 Jahre blieb der Täter unbekannt. Doch die Kriminal-beamten von Ludwigsburg ließen nicht locker und schickten 2003 die Kleider des Mädchens zum LKA. Die Kriminal-techniker fanden tatsächlich brauchbare DNA-Spuren, die von einem der früheren Verdächtigen stammten. 2005 wurde der Mann zu lebenslanger Haft verurteilt.
Eichenblatt überführt Mörder
Eine DNA-Analyse führte auch zur Aufklärung des Mordes an einer 30-jährigen Frau. Nur dass der Täter nicht aufgrund
seiner eigenen DNA überführt wurde, sondern aufgrund der eines Eichenblattes. Alle Indizien sprachen für den Ehemann als Täter, doch die Beweise reichten nicht aus. Bis das BKA fünf Jahre später ein Eichenblatt, das im Koff erraum des Verdächtigen sichergestellt wurde, molekular genetisch auswerten konnte. Dazu verglich das BKA das Eichenblatt mit Blättern von mehr als 40 Eichen am Leichenfundort. Mit Erfolg: Das Blatt stammte eindeutig von einem Baum direkt neben dem Fundort. Der Ehemann wurde 2006, acht Jahre nach der Tat, wegen Totschlags verurteilt. Das war weltweit das erste Strafverfahren, bei dem eine DNA-Analyse an Pfl anzen durchgeführt wurde und diese entscheidend zur Lösung des Falls beitrug.
Mit Hightech-Waff en auf Spurensuche
Das BKA verfügt als einzige Kriminalbehörde weltweit über ein Rasterelektronenmikroskop mit eingebautem Ionenstrahl. Dieses eine Million Euro teure Supermikroskop kann Partikel hunderttausendfach vergrößern. Dabei tastet das Gerät die Partikel nicht nur von außen ab, sein Ionen-strahl zerlegt sie, so dass die Wiesbadener Spezialisten das Innere von manipulierten Mikrochips in Wegfahrsperren oder Handys untersuchen können. Doch nicht nur die Labormethoden werden immer ausgeklügelter, auch die Spurensicherung rüstet kontinuierlich auf: So „frieren“ die Mitarbeiter des BKA Tatorte mithilfe einer vollsphärischen 360-Grad-Panoramakamera oder eines 3-D-Laserscanning-systems quasi ein. Der Scanner erfasst mit 500.000 Pixeln
HaysWorld 01/2011 | 25
pro Sekunde innerhalb kürzester Zeit das gesamte Umfeld im Radius von bis zu 79 Metern. Das Hightech-Gerät hält jedes noch so kleine Detail fest. Distanzen sowie Lage oder Größe von Objekten lassen sich jederzeit bestimmen. Die 3-D-Visualisierung des Tatortes ermöglicht verschiedene Auswertungen am Computer und erlaubt, Schusswinkel oder mögliche Sichtfelder von Tätern realistisch nachzu-stellen. Gilt es, empfi ndliche Eindruckspuren, wie Fuß- oder Reifenabdrücke in Erde, festzuhalten, kommt der Streifen-lichtmesser zum Einsatz. Dieser Oberfl ächenscanner erfasst die Spuren dreidimensional, ohne sie zu berühren – ein enormer Vorteil gegenüber dem Gips abdruck, der die Spuren oft beschädigte.
Seife bringt Aufklärung
Rund 5.000 Hülsen und ebenso viele Geschosse lagern zurzeit in der Munitionssammlung des BKA. Fallen am Tat -ort Schüsse, wird die Munition auf individuelle Merkmale untersucht. So lässt sich feststellen, ob die Waff e bereits bei früheren Straftaten benutzt wurde. Doch was, wenn weder Waff e, Hülse noch Munition am Tatort auffi ndbar sind? Ein Fall für das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern. Hier führt Dr. Beat Kneubuehl, Leiter des Zentrums Forensische Physik/Ballistik, Versuche mit ballistischer Gelatine oder Seife durch, beides ideale Surrogate für die Weichteile des menschlichen Körpers. Per Fernbedienung schießen Kneubuehl und sein Team mit unterschiedlichen Waff en aus verschiedenen Winkeln und Entfernungen
auf einen Gelatine- oder Seifenblock. Dank der durchsich -ti gen Gelatine können sie das dynamische Verhalten des Geschosses im Körper mit einer Hochgeschwindigkeits-kamera fi lmen und fotografi eren. Sollen Aussagen über die Wundhöhle getroff en werden, ist die Seife gefragt. Die Ergebnisse vergleicht der Experte für Wundballistik mit den magnetresonanz- und computertomografi schen Aufnahmen der Wunde und kann so eine Aussage über Waff e und Munition treff en.
Zurück nach Wiesbaden und zu einer Spurensicherung, die bei all den Hightech-Verfahren fast schon antiquiert wirkt. Die Rede ist von der Analyse von Fingerabdrücken. Auch hier hat sich in den letzten Jahren einiges getan. In der Vergangenheit war es beispielsweise kaum möglich, daktyloskopische Spuren, so der Fachbegriff , auf mensch-licher Haut zu sichern. Von 2000 bis 2005 führte das BKA zusammen mit verschiedenen Polizeidienststellen und rechts-medizinischen Instituten eine Versuchsreihe durch. Und tatsächlich gelang es, latente Fingerspuren auf Leichenhaut mit Ruß- oder Magnetpulver sichtbar zu machen. 20 Prozent der Fingerabdrücke waren zuordenbar. Seit August 2010 werden die Methoden in einem EU-Projekt optimiert.
Auf die Frage, warum Täter überhaupt noch Finger -ab drücke am Tatort hinterlassen, meint Haug: „Es lässt sich mit Handschuhen einfach nicht so gut arbeiten. Aber davon abgesehen, hinterlässt jeder Mensch allein durch den Hautabrieb ständig mikroskopisch kleine Partikel.“ Und die entdecken die Kriminaltechniker sowieso.
26 | HaysWorld 01/2011
Wir kommen auf die Welt und nach wenigen Wochen entdecken wir unser Selbst: Ich bin wer. Aber wer? Als Jugendliche suchen wir eine Antwort auf diese Frage und entwerfen ein Selbstkonzept, das mehr oder weniger Bestand hat. Sind wir erwachsen, kurbeln wir Schutzprozesse an, damit unser Selbstbildnis nicht erschüttert wird. Oder wir ändern unser Leben und werden unserem eigentlichen Selbst damit vielleicht gerechter.
DIE ENTDECKUNG DES SELBST
HaysWorld 01/2011 27
Von Britta Nonnast
Der klassische Meilenstein in der Entdeckung des Selbst wird gegen Ende des zweiten Lebensjahres gesetzt. „In dieser Phase entsteht ein Verständnis des Selbst als Objekt, als ,Me‘“, erklärt Prof. Dr. Birgit Elsner, Profes sorin für Entwicklungspsychologie an der Uni versität Potsdam.
Der Spiegeltest
Dieser Meilenstein in der Suche nach dem Selbst wird in der Forschung mit dem so genannten Spiegeltest fest gemacht. Ein Kind wird vor einen Spiegel gesetzt, mit einem farbi gen Punkt auf der Nase. Kinder, die ihr
„Me“ bereits entdeckt haben, bemerken den Fleck im eigenen Gesicht und versuchen ihn wegzuwischen. Sie identi fi zieren sich also mit ihrem Spiegelbild. „Diese Kinder sind in der Lage, sich selbst zum Objekt der Betrachtung zu machen. Das ist die Grundlage für die Fähigkeit, über sich selbst nachzudenken“, erklärt Elsner.
Die Entdeckung des „Selbst“ ist wesentlich
„Die Entdeckung des ,Me‘ ist Voraussetzung für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung. Eine gesunde Selbstwahrnehmung ist Grundvoraussetzung, um im Jugend- und Erwachsenenalter ein stabiles Selbstkonzept
Von Britta Nonnast
28 | HaysWorld 01/2011
und eine stabile Identität aufzubauen, sowie die Grundlage für das soziale Zusammenleben und das soziale Verständnis eines Menschen“, erklärt die Professorin.
Neuentdeckung des Selbst
Selbstkonzepte sollen möglichst stabil sein, doch als moderner Mensch hat man es mit sich ständig verändern-den Rahmenbedingungen zu tun. Die Psychologie empfi ehlt heute, die Identität nicht in Stein zu meißeln, da sich sowohl Arbeits- als auch Beziehungswelt sehr schnell verändern. „Wer fl exibel reagieren kann, hat einen Vorteil“, fasst Elnser zusammen. Das Umfeld, die Bedingungen und das eigene Selbst verändern sich fortlaufend. „Entwicklungspsychologen sprechen davon, dass wir uns ein Leben lang entwickeln, von der Wiege bis zur Bahre. Dabei ist die Entwicklung ein-gebettet in verschiedene Kontexte, wie Arbeitsplatz, Familie und die eigenen Ressourcen wie Gesundheit und persönliche Kompetenzen“, sagt Prof. Dr. Martin Pinquart, Entwicklungs-psychologe an der Universität Marburg. Entwicklung bein-haltet laut Psychologie aber nicht nur den Schritt auf eine höhere Entwicklungsebene, sondern auch einen Abbau und Verlust. Das impliziert auch, dass es kein Leben ohne Krisen gibt. Der Tod eines Angehörigen, Scheidung, Arbeitslosig-keit und Krankheit sind Einschnitte, vor denen niemand geschützt ist.
Die Suche nach dem Selbst als Erwachsener
Kleinere Misserfolge und Krisen werden von gesunden Menschen in der Regel verarbeitet und erschüttern das Selbst nicht nachhaltig. „Prozesse des Selbstwertschutzes bewirken, dass wir viele Misserfolge wegstecken können. Diese Prozesse können auch unbewusst ablaufen“, sagt Prof. Dr. Martin Pinquart. „Vor allem im höheren Erwachsenen-alter nehmen Selbstkonzeptschutzprozesse einen höheren Stellenwert ein als in der Jugend, da Menschen mehr mit Einschränkungen und Verlusten konfrontiert werden“, so der Marburger Professor.
Lassen sich die Probleme nicht mehr mit Schutzprozessen unter den Teppich kehren, beginnt die eigentliche Suche nach dem Selbst aufs Neue. „Wenn man in eine Krisen-situation gerät, in der einfach nichts mehr geht, werden auch Erwachsene wieder in die Phase der Identitätssuche
zurückgeworfen. Es muss aber nicht immer eine Krisen-situation sein, eine neue berufl iche Herausforderung zum Beispiel kann Ähnliches bewirken“, so Professorin Elsner.
Von Yoga bis Marathon
Auf der Suche nach sich selbst gibt es zahlreiche Weg-weiser zur Unterstützung: Heilfasten, Yoga, Meditation, spirituelle Reisen, Ausdruckstanz oder die 42 Kilometer Selbsterfahrung eines Marathons und viele Angebote mehr. Uwe Pettenberg, ehemals Betriebswirt und Inhaber einer großen Werbeagentur, hat sein Leben nach einer privaten Krise komplett umgekrempelt. Heute ist er psychotherapeu-tischer Heilpraktiker und seit zehn Jahren als Coach tätig. Er setzt einen sozialsystemischen Ansatz bei der Suche nach dem Selbst seiner Klienten an. „Die Entwicklung eines Menschen ist immer sozialsystemisch zu betrachten. Erfolge, Krisen, auch Krankheiten entstehen im Miteinander. Wir orientieren uns an anderen. Manche Menschen wissen nicht mehr, wer sie sind, da sie sich zu stark anderen angepasst haben, oder sind überperfekt, da sie als Kind nur dafür gelobt wurden, wenn sie Leistung erbracht haben.“ Auf der Suche nach dem Selbst stellt sich für Pettenberg immer die Kernfrage: „Wem fühle ich mich verbunden oder verpfl ichtet? Kann ich die Verbundenheit für mich wandeln?“
Mut zur Veränderung
Pettenberg kennt die Suche nach dem Selbst aus seinem Berufsalltag: „Typischerweise taucht die Frage nach dem Selbst in der zweiten Lebenshälfte auf.“ Auch Menschen, die berufl ich sehr erfolgreich sind, können ins Schwanken oder Grübeln geraten. Gerade dann ist der Druck oft sehr groß: „Es gibt Top-Führungskräfte, die berufl ich sehr erfolgreich sind, aber im Privaten kein Land sehen.“ Pettenberg erinnert sich an einen Klienten mit Burnout-Syndrom: „Der Mann arbeitete seit 25 Jahren erfolgreich in einer Bank, obwohl er keine Zahlen mochte. Und das nur, weil ihm die Bank zur Ersatzfamilie geworden war.“ Eine ehrliche Erkenntnis über das eigene Selbst ist die eine Sache, Mut zur Veränderung die andere. Man solle niemals voreilig sein, warnt Pettenberg: „Mut zur Veränderung heißt nicht, das totale Risiko einzu-gehen. Ein Umstieg, eine Veränderung muss strategisch geplant werden, denn Selbstverwirklichung ist Selbstver-antwortung.“
Prof. Dr. Birgit Elsner Entwicklungspsychologin an der Universität Potsdam
Uwe PettenbergPsychotherapeutischer Heilpraktiker und Coach
HaysWorld 01/2011 | 29
DIE ENTDECKUNG DES WELTRAUMS
Schon die großen Philosophen machten sich Gedanken über extraterrestrische Lebensformen. Der Italiener Giordano Bruno beispielsweise vertrat bereits im 16. Jahrhundert die Ansicht, dass das Weltall unendlich sein müsse und es auch auf anderen Planeten Lebewesen gebe. Diese Einschätzung brachte ihn allerdings auf den Scheiterhaufen. Doch mit zunehmender Verbreitung der Evolutionstheorie gewann seine These immer mehr Fürsprecher. Ein erster Durchbruch gelang den Forschern, als sie schließlich beweisen konnten, dass unsere Sonne nur ein Stern unter Milliarden ist.
Gibt es außerirdisches Leben? Seit der Erkenntnis, dass die Erde nur Teil eines Planetensystems ist, zählt diese Frage zu den spannendsten der Menschheit. Seit mehr als 500 Jahren beobachten Wissenschaftler mittlerweile das Weltall. Noch nie konnten dabei so viele bedeutende Entdeckungen gemacht werden wie in den vergangenen zwei Jahren.
Von Jan Gelbach
Harvard-Astronomin Lisa Kaltenegger vom Heidelberger Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA).
W
30 | HaysWorld 01/2011
Im Idealfall felsartig und klimatisch moderat
In den vergangenen zwei Jahren wurden doppelt so viele Planeten entdeckt wie in den 500 Jahren zuvor. „Wir kom-men langsam an den Punkt, an dem beantwortet werden kann, ob es einen anderen Planeten gibt, der unserer Erde ähnelt. Sozusagen weg von der Science-Fiction hin zu den Fakten“, erklärt die Harvard-Astronomin Lisa Kaltenegger. Am Heidelberger Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) berechnet sie die klimatischen Verhältnisse von extrasolaren Planeten. Diese so genannten Exoplaneten sind nicht Teil unseres Sonnensystems, sondern umkreisen den Stern eines anderen Planetensystems. „Abhängig von dessen Leucht-kraft und Größe lässt sich eine ‚habitable Zone‘ errechnen, in der auf felsartigen Planeten theoretisch Leben möglich sein könnte“, erklärt Kaltenegger. Sind die Temperaturen moderat genug, damit Wasser in fl üssigem Zustand vor-kommt, ist nach Ansicht der Forscher die Grundvoraus-setzung für Leben gegeben.
Auf der Suche nach neuen Welten
Das seit zwei Jahren von der NASA betriebene Weltraum-teleskop Kepler entdeckte bislang mehr als 1.200 neue Planetenkandidaten, von denen 54 in der habitablen Zone liegen, darunter auch einige kleine Planeten, die erdähnlich sein könnten. „Wir sind begeistert von der unfassbaren Menge an Planeten, denn Kepler kann nur etwa 1/400 des Himmels erfassen. Es sind zwar noch längst nicht alle Kepler-Planeten bestätigt, aber die Quote müsste bei 80 Prozent liegen“, betont Kaltenegger. Damit ein Exoplanet als „con-fi rmed“ gilt, müssen ihn mehrere Forschungseinrichtungen fi nden können oder er muss mit zwei unterschiedlichen Methoden nachweisbar sein. Den ersten Exoplaneten, der einen Stern ähnlich unserer Sonne umkreist, entdeckten 1995 die Schweizer Michel Mayor und Didier Queloz durch die Wobble-Methode mithilfe eines hochaufl ösenden Spektro-grafen. Bei dieser Methode werden die Absorptionslinien eines Sternes beobachtet, die sich je nach Bewegung des Planeten verschieben. Blaue Linien zeigen an, dass sich der Stern auf die Erde zubewegt, verändern sich die Linien nach Rot, entfernt er sich von ihr.
Lässt sich beides beobachten, kann angenommen werden, dass sich ein Planet auf einer Umlaufbahn um den Stern bewegt. Denn nicht nur der Stern übt eine Anziehungskraft
auf den Planeten aus, sondern auch der Planet auf den Stern. Dadurch wird das System an Ort und Stelle gehalten, der Stern „wobbelt“ auf einer winzigen Umlaufbahn. Ohne „Gegenspieler“ bewegt sich ein Stern hingegen nur in eine Richtung.
Die neuere Methode, mit der Kepler nach Planeten forscht, ist das Transit-Verfahren. Schiebt sich ein Planet zwischen Beobachter und Stern, entsteht eine Art Sonnenfi nsternis. Der Stern wird partiell dunkler. „Ist dies in drei aufeinander folgenden Umläufen zu beobachten, handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen neuen Planeten. Aller-dings funktioniert diese Methode nur, wenn Teleskop, Stern und Planet auf einer Ebene liegen. Planeten, die zu stark von dieser Ebene abweichen, können nicht erfasst werden“, erläutert Kaltenegger. Im Wahrnehmungsschatten des Kepler-Teleskops könnten sich also noch weit mehr Planeten befi nden.
Die Wahrheit steht in den Sternen
Die jüngste Entdeckung des Teleskops ist zugleich die spektakulärste. Im Februar 2011 wurde ein rund 2.000 Lichtjahre von der Erde entferntes System mit sechs Transit-Planeten entdeckt, die sich auf einer Ebene bewegen. Damit gleicht das System mit dem Namen Kepler-11 unse-rem Sonnensystem. „Bisher konnten wir trotz der Vielzahl an Planetenfunden nicht beweisen, dass es eine solche Konstellation wie in unserem Sonnensystem noch einmal gibt, obwohl es zu vermuten war. Kepler hat nicht nur den Beweis erbracht, sondern auch gezeigt, welch unglaubliche Masse an Planeten es geben muss. Basierend auf diesen ersten Ergebnissen muss die Wahrscheinlichkeit, dass sich darunter erdähnliche befi nden, recht hoch sein. Da wir wissen, dass selbst unter widrigsten Umständen auf unserer Erde Leben existieren kann, liegt es statistisch betrachtet nah, dass irgendwo da draußen intelligentes Leben ist“, resümiert Kaltenegger. Für das Jahr 2020 plant die NASA bereits die nächste große Mission. Sollte es eine Exoplaneten-Mission werden, dürfen wir spätestens 2030 mit noch spektakuläreren Entdeckungen rechnen. „Das Kepler-Projekt liefert uns statistische Ergebnisse, anhand derer ein ent-sprechend leistungsfähiges Teleskop gebaut werden kann, das verhältnismäßig nahe gelegene Sterne und Planeten auffi ndbar macht“, erklärt Kaltenegger. Denn die nächste Erde ist vielleicht gar nicht so weit weg.
Unser Blick ins Universum wird immer genauer: Diese spektakuläre Aufnahme zeigt den so genannten Ringnebel im Sternbild Leier (Messier-Katalognummer 57) in nie gekannter Detailschärfe.
W
HaysWorld 01/2011 | 31
Organisations- und Arbeitsstrukturen in Bewegung
Deutsche Unternehmen haben ihre Arbeits- und Organisa-tionsstrukturen bereits in hohem Maße fl exibilisiert und dies weitgehend abgeschlossen. Nun geht es darum, die einzel-nen Flexibilisierungsmaßnahmen zu optimieren. Dies sind die Kernergebnisse einer Studie des Instituts für Beschäfti-gung und Employability (IBE) der Hochschule Ludwigs-hafen und der Hays AG. Befragt wurden 451 Führungskräfte aus Unternehmen und Organisationen. In den Betrieben sind variable Arbeitsbeziehungen fast fl ächendeckend etabliert. So nutzen mehr als 90 Prozent der befragten Unternehmen befristete Arbeitsverträge. Die große Mehr-heit der Unternehmen setzt außerdem Freelancer (86 Pro-zent) und Zeitarbeiter ein (70 Prozent), um schnell auf veränderte Märkte zu reagieren. Weitere Informationen unter www.hays.de/studien
Perspektive 2025: Fachkräfte für Deutschland
Der deutsche Arbeitsmarkt ist im Umbruch: Während die vergangenen Jahrzehnte von Strukturwandel und hohen Arbeitslosenquoten geprägt waren, erlebt die Nachfrage nach Arbeitskräften derzeit einen regelrechten Boom. In einigen Branchen und Regionen werden bereits heute die Fachkräfte knapp. Dies ist keineswegs nur ein Strohfeuer. Denn auf Grund der demografi schen Entwick-lung wird das Erwerbspersonenpotenzial bis zum Jahr 2025 um rund 6,5 Millionen Personen sinken – und damit auch das Angebot an qualifi zierten Fachkräften. Wenn nicht aktiv gegengesteuert wird, fehlt es in Zukunft also deutlich an jenen Fachkräften, die ein Motor für Wachs-tum und Wohlstand sind. Doch Deutschland hat alle Chancen, dieser Entwicklung entgegenzuwirken und den Wandel aktiv zu gestalten. Allerdings erfordert dies einen breiten Ansatz, der viele Hebel nutzt, Denk-gewohnheiten aufbricht und Positionen hinterfragt – dieser Herausforderung stellt sich die Bundesagentur für Arbeit: Mit der Publikation „Perspektive 2025 – Fachkräfte für Deutschland“ will sie die Debatte auf einer soliden Faktenbasis führen. Weitere Informationen unter www.arbeitsagentur.de
Bericht „Creating Jobs in a Global Economy“
Gemeinsam mit dem Unternehmen für Wirtschafts pro-gnostik Oxford Economics hat der PersonaldienstleisterHays plc. den Bericht „Creating Jobs in a Global Economy“ erarbeitet. Er verdeutlicht die Herausforderungen, denen Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Regierungen weltweit gegenüberstehen.
NEWS UND TERMINE
LERNEN SIE HAYS BEI FOLGENDEN VERANSTALTUNGEN PERSÖNLICH KENNEN
19.–20. Mai 2011ReWeCoFührende deutsche Kongressmesse für den Bereich Rechnungswesen und ControllingRAMADA Hotel, Berlin
28. Juni 2011VDI nachrichten Recruiting TagKarrieremesse für IngenieureForum am Schlosspark, Ludwigsburg
13. September 2011VDI nachrichten Recruiting TagKarrieremesse für IngenieureKongresshaus, Zürich
20.–22. September 2011Zukunft PersonalEuropas größte Fachmesse für Personalmanagement Koelnmesse, Köln
So prognostiziert der Bericht die dramatischen Verschie-bungen von Arbeitskräften, Macht und Wohlstand auf der ganzen Welt in den kommenden 20 Jahren. Die Zahl der Erwerbsfähigen soll in diesem Zeitraum um über eine Milli-arde Menschen ansteigen. Das Wachstum fi ndet jedoch nur in den Entwicklungsländern statt. Die Erwerbsfähigen in der entwickelten Welt werden hingegen weniger und älter.
Regierungen und Industrie müssen sich auf den Umgang mit diesem Ungleichgewicht vorbereiten – einerseits, um das wirtschaftliche Potenzial dieser größeren Zahl von Erwerbs -fähigen zu nutzen, andererseits, um Qualifi kationen heran-zubilden, die sonst in vielen Bereichen knapp würden. Entwicklungsmärkte werden eine Periode mit rascher Industrialisierung und schnellem Infrastrukturausbau erleben, wozu qualifi zierte, erfahrene Arbeitnehmer benötigt werden, die auf heimischen Märkten nicht in ausreichender Zahl verfügbar sind. Entwickelte Märkte hingegen werden Wege fi nden müssen, ihren Wettbewerbsvorteil in Schlüsselindus-trien aufrechtzuerhalten, indem sie in die in der Zukunft benötigten Qualifi kationen investieren, auch wenn dies vor dem Hintergrund eines kleineren und älteren Arbeitnehmer-pools geschieht. Der komplette Bericht steht unter: http://haysoxfordeconomics.clikpages.co.uk/globalreport2011/ zum Download bereit.
Hays Willy-Brandt-Platz 1–3 68161 MannheimT: +49 (0)621 1788-0F: +49 (0)621 1788 1299 [email protected]
Unsere Niederlassungen fi nden Sie unterwww.hays.de/standorte
Hays (Schweiz) AG Nüschelerstrasse 328001 ZürichT: +41 (0)44 225 50 00F: +41 (0)44 225 52 [email protected]
Unsere Niederlassungen fi nden Sie unter www.hays.ch/standorte
Hays Österreich GmbH Personnel Services Marc-Aurel-Straße 41010 WienT: +43 (0) 1 5353 443-0F: +43 (0) 1 5353 443 [email protected]
Die Marke HAYS und das H-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Hays. © HAYS 2011